- Trainer/in: Melika Ahmetovic
- Trainer/in: Sophia Arndt
- Trainer/in: Laura Breitscheidel
- Trainer/in: Melika Ahmetovic
- Trainer/in: Sophia Arndt
- Trainer/in: Laura Breitscheidel
- Trainer/in: Sarah Denzer
- Trainer/in: Melika Ahmetovic
- Trainer/in: Pierre-Carl Link
Sehr geehrte Studierende,
die Qualität pädagogischer Beziehungen ist zentral für die persönliche Entwicklung, das kognitive Lernen und die demokratische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. In dieser Lehrveranstaltung bieten wir Ihnen eine intensive Auseinandersetzung mit den folgenden Fragestellungen an:
- Warum sind pädagogische Beziehungen von Relevanz?
- Was kennzeichnet gute Beziehungen in pädagogischen Settings?
- Welche kinderrechtlichen Grundlagen gibt es zum Themenbereich pädagogische Beziehungen?
- Welche bedeutsamen Forschungsbefunde zur Qualität pädagogischer Beziehungen liegen vor?
- Welche Möglichkeiten gibt es, die Qualität pädagogischer Beziehungen in der Praxis zu verbessern?
In acht Modulen erarbeiten Sie sich asynchron die Notwendigkeit und Relevanz einer Ethischen Pädagogik, um, wie der Psychoanalytiker Donald Winnicott sagt, pädagogische Beziehungen "good enough" anzubieten.
- Modul 1: Einführung in das Thema pädagogische Beziehungen (Was sind pädagogische Beziehungen? Warum sind sie bedeutsam? Welche Rolle spielen Fürsorge ("Caring"), Macht und erfülltes Leben?).
- Modul 2: Reckahn und die Reckahner Reflexionen (Was ist ethisch begründet? Was ist ethisch unzulässig?).
- Modul 3: Rechtliche und bildungspolitische Grundlagen (Welche rechtllichen Grundlaagen gibt es zu dem Thema?).
- Modul 4: Ergebenisse aus der Forschung (Was wissen wir aus der Forschung über die Qualität pädagogischer Beziehungen? Wie lassen sich hierzu Daten erheben?).
Darauf aufbauend werden vertiefte Inhalte zu den Themen pädagogische Beziehungen angeboten und Selbstreflexion angeregt sowie zu einer Auseinandersetzung mit biografischen Erfahrungen und zum kollegialen Austausch.
- Modul 5: Vertiefung Reckahner Reflexionen
- Modul 6: Fallarbeit
- Modul 7: Biographie-Arbeit
- Modul 8: Herausforderung bei der Vermittlung der Reckahner Reflexionen
Das Seminar ist asynchron im Blended-Learning-Stil gestaltet, damit Sie sich die Zeit der Bearbeitung der Inputs selbstständig und möglichst flexibel einteilen können. Alle zwei Wochen wird es eine Möglichkeit zur Reflexion via Zoom mit dem Seminarleiter geben.
Freundliche Grüße,
Pierre-C. Link
Kontakt: pierre.link@lmu.de
- Trainer/in: Pierre-Carl Link
- Trainer/in: Theresa Ameling
- Trainer/in: Jürgen Schuhmacher
- Trainer/in: Tatjana Eckerlein
- Trainer/in: Jürgen Schuhmacher
- Trainer/in: Stefanie Fiocchetta
- Trainer/in: Barbara Heindl
- Trainer/in: Stefanie Fiocchetta
- Trainer/in: Marissa Vogel
- Trainer/in: Nadine Jene
- Trainer/in: Nadine Jene
- Trainer/in: Sabine Prepens
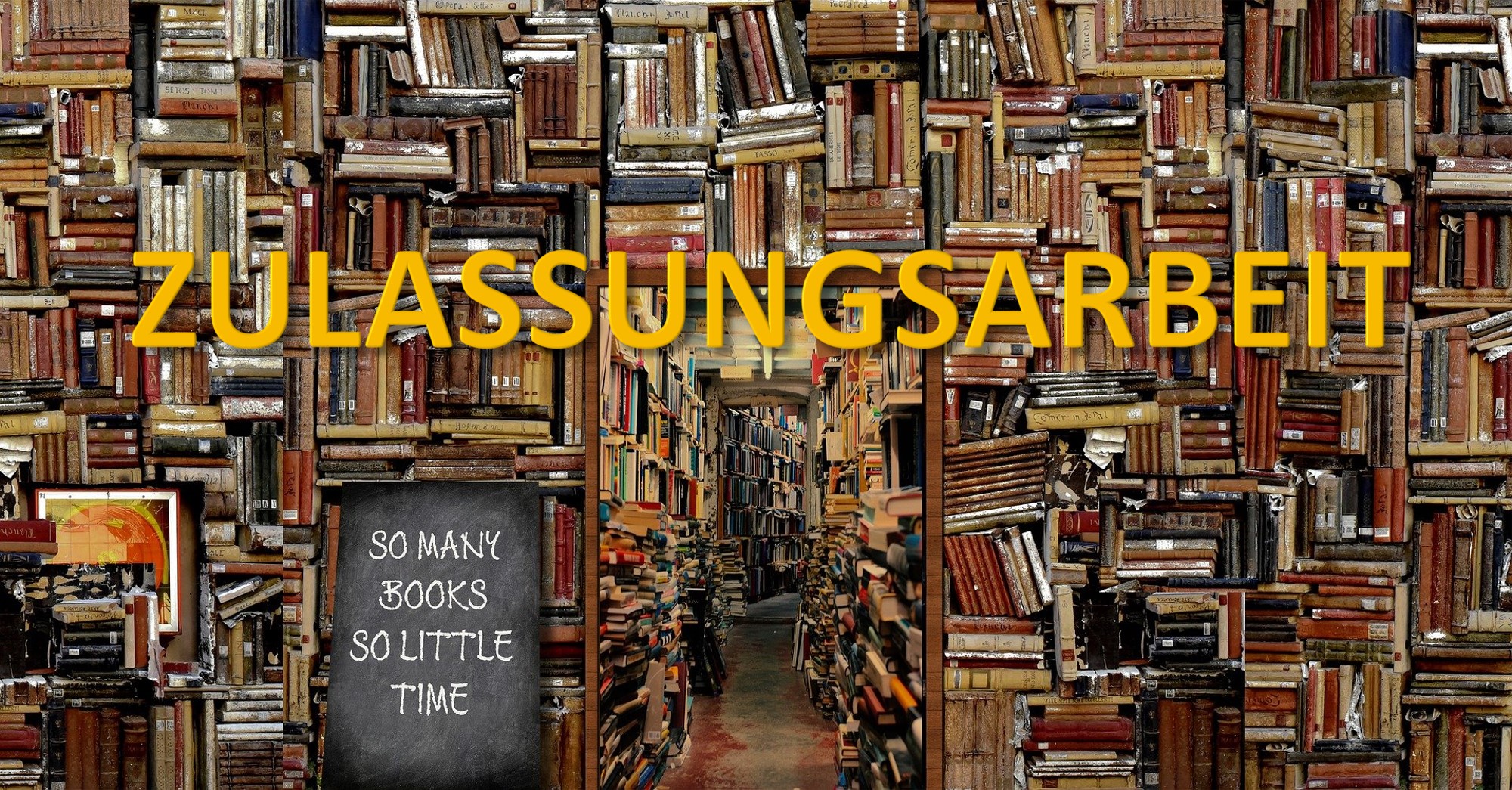
- Trainer/in: Sophia Arndt
- Trainer/in: Bernhard Bley
- Trainer/in: Laura Breitscheidel
- Trainer/in: Daniela Michnay-Stolz
Der Kurs führt mit Bezug zu sprachheilpädagogischen Fragestellungen in die empirische quantitative Forschungsmethodik ein.
Neben der Vermittlung der theoretischen Grundlagen liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Anwendung: Auf Basis von computergestützten Datenanalysen mit dem Programm SPSS wird ein "Statistisches Portfolio" angefertigt.
- Trainer/in: Maximilian Hamann
- Trainer/in: Sophia Al Saroori
- Trainer/in: Susanne Bjarsch
- Trainer/in: Rebecca Kainz
- Trainer/in: Gesa Lühmann
- Trainer/in: Kristina Maricic
- Trainer/in: Josephine Schratzenstaller
Reflexion und Evaluation einer mobilen Anwendungssoftware (App) zum Förderkonzept "Strategieorientierte Förderung des mathematischen Faktenwissens (Einmaleins)"
Im Rahmen vorangegangener Forschungsseminare (WiSe 17/18 bis SoSe 2020) zu den Zusammenhängen zwischen sprachlichen Fähigkeiten und mathematischen Kompetenzen ist im zweiten Teil des Projektes ein Förderprogramm entstanden, das spracherwerbsgestörten Kindern den Erwerb mathematischen Faktenwissens (Einmaleins) erleichtern soll. Das Interventionskonzept zielt darauf ab, Kindern mit spezifischen Spracherwerbsstörungen und mathematischen Lernschwierigkeiten das Herleiten von Einmaleinsaufgaben und deren Ergebnissen sowie den automatisierten Abruf des Gelernten zu ermöglichen. Hierfür erlernen die Kinder im Laufe des Förderprogramms heuristische Strategien ("grundsätzliche Vorgehensweisen, wie man in einer Problemsituation agieren kann“) sowie eine Speicherstrategie, den sogenannten “Speicher-Rap“.
Dieses Forschungsseminar verfolgt das Ziel, den ersten Prototypen der auf sprachtherapeutischen Prinzipien aufbauenden mobilen Anwendungssoftware (App) in einem iterativen Prozess hinsichtlich der Funktionsweise und Bedienung kritisch zu reflektieren und zu überarbeiten. Im Anschluss soll die App qualitativ evaluiert werden, indem der Umgang/ die Arbeit mit der App kriterienorientiert beobachtet wird.
Teilnehmen können Studierende des Lehramtsstudienganges Sonderpädagogik (Förderschwerpunkt Sprache), die Interesse an den Themen "Medien im Unterricht", "Computergestützte Intervention" sowie "Effiktivität mobilen Sprach- und Mathematiklernens" haben und sich didaktisch kreativ beteiligen möchten.
- Trainer/in: Maximilian Hamann
- Trainer/in: Marin Zec